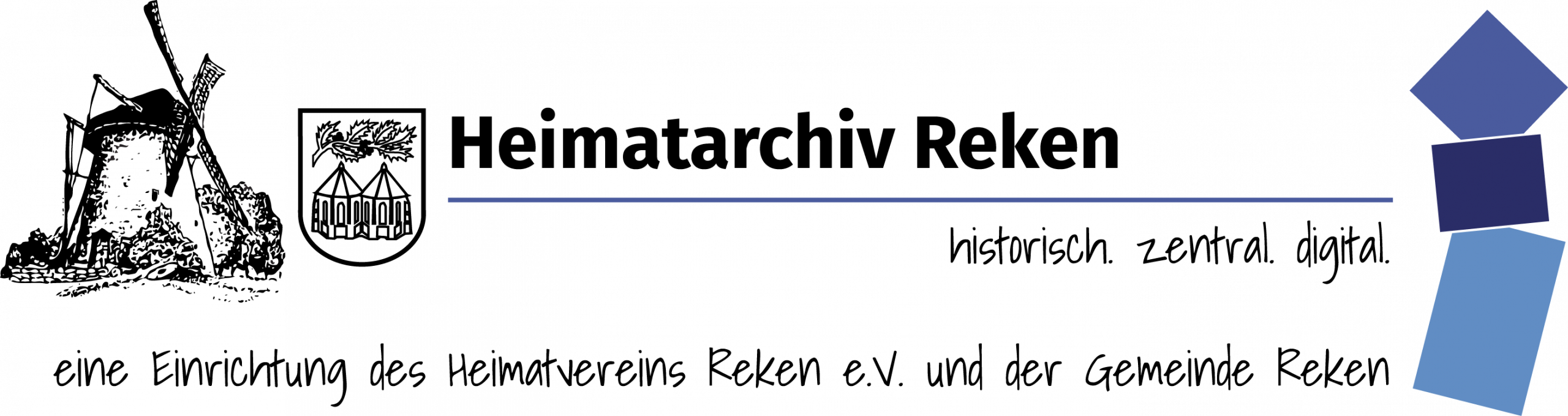Die jüdische Gemeinde Reken
Auch in Reken war die Zustimmung zum NS-Regime in den Jahren nach 1933 bis zum Überfall auf die Sowjetunion kontinuierlich angewachsen. Nicht umsonst bestand lange Zeit weitgehende Übereinstimmung unter vielen Zeitgenossen, dass das „Dritte Reich“ mindestens bis zum Russlandfeldzug als „schöne Zeit“ zu beschreiben sei. Das nationalsozialistische Projekt bot ja nicht nur eine glanzvoll ästhetisierend ausgemalte Zukunft, sondern auch ganz handfeste Gegenwartsvorteile wie zum Beispiel Karrierechancen in den zahlreichen von Bürgermeister Bösing im Frühjahr 1934 initiierten Vereinen und Organisationen.
Unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 setzte auch hier eine ungeheuer beschleunigte Praxis der Ausgrenzung der Juden ein, und zwar ohne relevanten Widerstand der Mehrheitsbevölkerung – obwohl mancher vielleicht über den „SA- und Nazipöbel“ die Nase rümpfte oder die einsetzende Kaskade der antijüdischen Maßnahmen als unfein, ungehörig, übertrieben oder einfach als inhuman empfand: Ausgrenzung, Verfolgung und Beraubung der Anderen wurden kategorial nicht als solche erlebt, weil diese Anderen – „die Juden“ – per Definition gar nicht mehr dazugehörten und ihre antisoziale Behandlung Moralität und Sozialität der „Volksgemeinschaft“ nicht mehr berührte.
Alle Einzelschritte des sozialen Ausgrenzungsprozesses der jüdischen Rekener fanden in der Öffentlichkeit statt. Vom Tag der so genannten Machtergreifung an vollzog sich ein fundamentaler Wertewandel, in dem es zunehmend als normal empfunden wurde, dass es kategorial unterschiedliche Menschengruppen gab, für die entsprechend unterschiedliche Normen des zwischenmenschlichen Umgangs auf der einen und der Rechtsetzung und -anwendung auf der anderen Seite galten. In verblüffend kurzer Zeit galten für die jüdischen Mitbürger Normen wie Gerechtigkeit, Mitleid oder Nächstenliebe nicht mehr, verschwand eine humane Grundierung.
Anfang März 1933 meldete die Borkener Zeitung, dass auf das Kaufhaus Lebenstein ein Brandanschlag verübt worden war, der durch die rasch alarmierte Feuerwehr in Grenzen gehalten werden konnte und keinen größeren Schaden anrichtete. Mag diese Tat das Werk eines Einzelnen ohne systematisch geplanten politischen Hintergrund gewesen sein, ermittelt wurde gegen den bekannten Brandstifter nicht.

Ein anderes Ereignis zeigt sehr deutlich, wohin die Reise ging: Hermann Levinstein und Samuel Silberschmidt wurden im Herbst 1933 „auf höhere Anweisung“ wegen jüdischer Rassenzugehörigkeit aus der Groß-Rekener Feuerwehr ausgeschlossen. Dass daraufhin acht Kameraden aus Protest die Wehr verließen, zeugt sicherlich vom Mut dieser Männer, aber auch davon, dass die Nationalsozialisten damals noch nicht vollständig ihre perfekt durchorganisierte, lähmende Furcht verbreitende Polizeidiktatur etabliert hatten.
Systematisch wurden die jüdischen Mitbürger ab März 1933 aus dem öffentlichen und dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen, wie die folgenden Auswahl zeigt:
- 1.4.33: Rekener SA- Männer führen den ersten „Judenboykott“ in der Dorfstraße durch
- 18.5.33: Rekener Geschäftsleute gründen den Kampfbund des Mittelstandes: „Deutsche, kauft in christlichen Geschäften“
- 25.5.33: Gründung einer „NS-Frauenschaft“ in Groß-Reken. Damit sind jüdische Frauen „draußen“
- 23.6.33: Der Kampfbund des Mittelstandes beschwert sich, dass der Benediktushof seinen Bedarf immer noch im Kaufhaus Levinstein decke. Landrat Dr. Cremerius erklärt, er habe schon „vor längerer Zeit“ veranlasst, dass nur noch in „christlichen Geschäften“ einzukaufen sei
… usw.
Anfang 1937 schließlich wurde Samuel Silberschmidt seine Konzession als Viehhändler entzogen.
Die ständige Verschärfung der Repressionen gegen Juden verfehlte auch in Reken nicht ihre Wirkung. Hermann Levinstein verlor seine Aufsichtsratspositionen bei den Banken, und es wurde immer schwieriger, das Geschäft aufrechtzuerhalten.
Selbstmord von Berta Levinstein

Mit den Geschäften bei Levinsteins ging es durch die ständige Hetze, die Verleumdungen und auch die zunehmende Entrechtung der Juden immer schlechter.
Aus Verzweiflung über ihre familiäre Situation nahm sich Berta Levinstein im Jahre 1937 das Leben. Viele Groß Rekener waren darüber sehr betroffen, denn Berta hatte etlichen Menschen in den schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg geholfen und besonders das Groß-Rekener Krankenhaus unterstützt.